© 2005 Tyll Zybura | windfeder@wolkenturm.de | Quelle: www.wolkenturm.de 1 Tyll
© 2005 Tyll Zybura | windfeder@wolkenturm.de | Quelle: www.wolkenturm.de 1 Tyll Zybura Die tulamidische Gildenmagie Stand: xy-08-05 Diese inoffizielle Spielhilfe will die offiziellen Texte zur Magie der Tulamiden in der Spielhilfe Land der Ersten Sonne (S.43ff.) ergänzen und ausführen, indem noch stärker auf spezifisch tulamidische Lehrtraditionen eingegangen wird. Einleitung Die Magietradition im Land der Ersten Sonne hat sich zwar in den zwei Jahrtausenden des Kontakts mit bosparanischer Gildenmagie stark mit dieser vermischt, doch haben die Tu- lamiden als uralte Hochkultur auch viele ihrer eigenen arkanen Bräuche, Lehrmethoden und Traditionen bewahrt. So hat die tulamidische Magie viele Eigenheiten, die sie von der Gildenmagie, wie man sie in Punin, Festum, Vinsalt oder Al’Anfa praktiziert, stark unter- scheidet. Insbesondere pflegen tulamidische Magier eine stärker ritualisierte und nach ästhetischen Gesichtspunkten ausgeformte Zauberpraxis, deren Wurzeln die alten Repräsentationen der Kophtanim und der Mudramulim sind (siehe dazu LdES 43 und MWW 180). Die Essenz der Kunst der Mudramulim wird dabei vor allem im Magiewirken unter Einsatz von Edelsteinen und Arkanoglyphen gesehen (das al’mudrar), während die Kophtanim nach Meinung vieler tulamidischer Magier Großmeister der Spruch- und Rezitationszauberei (al’mantrar) waren. (Tatsächlich ist diese Unterscheidung eine künstliche, die erst etwa 1.000 BF aus dem Bemühen erwachsen ist, die alten Traditionen zu bewahren.) Wie genau diese beiden Künste praktiziert werden, wird der erste Teil dieser Abhandlung erläutern. Der zweite Abschnitt behandelt eine weitere Besonderheit tulamidischer Gildenmagie, nämlich die Art der Lehre: Sie unterscheidet sich von der ‘bosparanischen’ dadurch, dass sie persönlichen Lehrmeistern weit höhere Bedeutung zukommen lässt, denn Unabhängig- keit ist ein Zeichen von Macht. Auch im akademischen Kontext studiert man meist bei ausgewählten Mentoren, durchstrukturierte Fächersysteme oder Curricula finden kaum Anwendung. © 2005 Tyll Zybura | windfeder@wolkenturm.de | Quelle: www.wolkenturm.de 2 Im dritten Abschnitt werden einige bekannte oder besondere Zaubersprüche in ihrer tula- midischen Form mit Übersetzung aufgelistet. Diese Spielhilfe wurde im August 2005 überarbeitet und an die offiziellen Quellen zu tulamidi- scher Magie in LdES, MWW und RA angepasst. Trotzdem ist ein Großteil des Vokabulars in- offiziell. Weitere Informationen zu Details des tulamidischen Elementarismus sind im Hexalogicon <http://www.hexalogicon.de> zu finden. Sprache und Schrift – tulamidische Zauberpraxis Die gesprochene Zauberformel und ihre schriftliche Fixierung bilden den Kern der gil- denmagischen Repräsentation. In der tulamidischen Tradition besitzen beide Formen der Zauberhandlung ausgeprägte künstlerische Gestalt, denn die Kinder Tulams sind über alle Maßen stolz auf ihre Sprache und die anspruchsvolle Silbenschrift des Tulamidya. Auch die dritte wichtige Komponente – die Zaubergeste – soll in urtulamidischer Ritual- zauberei durch labyrinthische Schreittänze und komplexe Glyphengesten eine kunstvolle Ausformung gehabt haben, jedoch sind diese langwierigen Zauberhandlungen größtenteils in Vergessenheit geraten. Tulamidische Zauberer führen in der Regel die gleichen Gesten aus, wie ihre Collegae im bosparanisch geprägten Aventurien. Al’mantrar – gesungene Magie Das tulamidische Wort für ‘Zauberspruch’ lautet mantra (Plural: mantranim) und kann auch ‘Gebet’ oder ‘Hymne’ bedeuten (RA 86, man beachte die Parallele zum bosparanischen cantus ‘Zauberspruch’, aber auch ‘Lied’). Von diesem Wort leitet sich die Kunst des al’mantrar ab, die tulamidische Magier für die Ausübung von Spruchzauberei erlernen: Sie praktizieren eine Art Sprechgesang, eine melodische Rezitation der magischen Formeln, die meist sowohl eine kurze Versform als auch eine lange Gedichtform haben. Tulamidische Zauberformeln werden sowohl in modernem Tulamidya als auch in Ur- Tulamidya überliefert. Letzteres ist als Schriftsprache der tulamidischen Gelehrten in Gebrauch und deswegen verwenden die meisten Magier ebenfalls die Ur-Tulamidya-Form eines mantras. Ein laut vorgetragenenes mantrar bringt dabei die ganze Ehrwürdigkeit und Melodik des Ur-Tulamidya zur Geltung, in welchem auch für einfache Tulamiden ein Hauch von Mystik und Macht mitschwingt. Die Kunst des Zaubersingens zu beherrschen ist ein hohes Ziel vieler tulamidischer Magier, und sie lässt sich über verschiedene formali- sierte Stufen zu einer beeindruckenden Perfektion bringen. Über die uralten Wurzeln des al’mantrar geben insbesondere die großen tulamidischen Mär- chen Auskunft: Dort wird von tagelangen Rezitationsduellen zwischen Zauberern berich- tet, bei denen sich die widerstreitenden Melodien in sphärische Dimensionen erheben und © 2005 Tyll Zybura | windfeder@wolkenturm.de | Quelle: www.wolkenturm.de 3 welterschütternde Wirkung erreichen! Und auch von Bastrabun al’Sheik wird erzählt, dass seine mächtigste Waffe gegen die Echsen ein gewaltiges Zauberlied war, mit dem er die Geschuppten zurückdrängen konnte. Es heißt, Bastrabuns Bann erklänge noch heute an der Banngrenze der südlichen Echsensümpfe ... Al’mudrar – geschriebene Magie Das geschriebene (Ur-)Tulamidya kennt unzählige verschiedene Schriftstile die jeweils für bestimmte Anlässe, Themen oder Materialien geschaffen wurden. Die Kalligraphie gilt im Land der Ersten Sonne als eine der höchsten Künste überhaupt – mehr über die tulamidi- sche Schriftkunst ist in LdES 35ff. zu erfahren. Die kalligraphisch äußerst komplizierten Niederschriften von Zauberformeln und -liedern, werden im Tulamidya mudranim (Einzahl: mudra) genannt (nicht zu verwechseln mit den aus sich heraus wirkungsmächtigen Arkanoglyphen, die die gleiche Bezeichnung tragen). Das Verfertigen dieser Thesismatrizen heißt al’mudrar und ist eine Kunst, der alle tulamidischen Magier viel Zeit und Hingabe widmen, die jedoch nur wenige Meister in Perfektion beherr- schen. Während eine beispielsweise nach der Puniner Matrizentheorie niedergeschriebene Thesis technisch anmutet und selbst bei hoher Komplexität eine klare Geometrie besitzt, wirkt das mudra einer tulamidischen Meisterin verschlungen und geheimnisvoll: Seine Struktur ist tiefer, versteckter, geschmeidiger – sie stellt dem Betrachter gleichsam ein philosophisches Sinnrätsel, während die Puniner Thesis eine arcano-mathematische Übung aufgibt. Die Tradition des al’mudrar ist eng verbunden mit der prächtigen (nicht-arkanen) tulamidi- schen Ornamentalistik, so dass sich thesisähnliche Glyphen und Verzierungen überall in der tulamidischen Region auf Gegenständen, Möbeln oder Türrahmen finden lassen – auch profane Kalligraphen haben nicht selten eine gewisse Kenntnis der mudranim (was sich ja auch in der Professionsvariante Kalligraph niederschlägt, LdES 187). Lehren und Lernen im Land der Ersten Sonne Die tulamidische Form der Lehre – nicht nur in der Zauberkunst – ist stark individualis- tisch: Persönliche Lehrmeister nehmen nicht selten die Rolle von väterlichen oder mütterli- chen Mentoren und Mentorinnen ein, die für ihre Schüler das ganze Leben lang bedeutsam bleiben. Doch gibt es durchaus eine lange Tradition der philosophischen Schulenbildung, die wir zunächst betrachten wollen: © 2005 Tyll Zybura | windfeder@wolkenturm.de | Quelle: www.wolkenturm.de 4 Von Schulen und Wegen Eine tulamidische chamib (Plural: chamibûn, als üblicher Sammelbegriff für Schulen, Akade- mien und Zirkel) beinhaltet meist auch eine bestimmte Philosophie, eine Denk- und oft auch eine Lebensweise. Dies ist unabhängig davon, welche Art von Wissen oder Fähigkei- ten sie vermittelt: sei es eine Schule des Rote-und-weiße-Kamele-Spiels in Khunchom, die Ärzte- schule von Rashdul, eine Kriegerakademie, eine mysteriöse Qabalya – oder eben eine der verschiedenen Zauberschulen des Tulamidenlandes. Jeder dieser chamibûn liegt eine Denkrichtung zugrunde und diese Denkrichtungen werden tariqanim (Wege, Einzahl: tariqa) genannt. Je älter ein solcher ‘Weg’ (des Denkens oder Wis- sens) ist, desto respektabler und ehrwürdiger ist die Gemeinschaft, die sich ihr verschrieben hat – manche Traditionen reichen in die Jahrtausende zurück. Exkurs: Etymologie des Begriffs tariqa Das Wort tariqa ist sehr alt und hat verschiedene Bedeutungswandlungen erfahren: In den Erzählungen aus der Anfangszeit der Tulamiden, die von den Kämpfen gegen mächtige Echsen in den Ebenen und Urwäldern südlich des Rashtulswalls berichten, hei- ßen jene Helden Zultariqim, die sich auf den gefahrvollen ‘Weg des Blutes’ (zul: Blut) wag- ten um den Kampf mit den Starräugigen zu suchen. In der beginnenden Zivilisation schließlich meinte tariqa das normale bäuerliche Leben in Gehorsam gegenüber dem jeweiligen Herrscher. Doch in den Zeiten der Pracht und Weis- heit während des Diamantenen Sultanats wurde das Wort schließlich zum Inbegriff des ‘geistigen Weges’ der Gelehrten und Zauberer – diese Bedeutung ist auch heute noch vor- herrschend. Die Wüstenstämme der Novadis wiederum bezeichnen den instinktiven Weg eines Kamels zur unsichtbaren Wasserstelle als tariqa, während ihre Mawdliyat mit dem Wort ihren eige- nen Lebensweg in Annährung an den einen Gott beschreiben. Anhand dieser vielfachen Bezüge wird deutlich, dass dieser ‘Weg’ einer jeden gelehrten Gemeinschaft nicht nur eine bestimmte Meinung oder theoretische Position widerspiegelt, sondern dass er durchaus existentielle Bedeutung hat: Die tariqa gibt dem Leben und Han- deln eines Menschen Sinn und Richtung, denn jeder Weg hat auch ein Ziel. Es ist dabei bezeichnend, dass es im Tulamidya kein Wort für dieses Ziel des Weges gibt, denn die tulamidische Philosophie pflegt seit ihrer fruchtbringendsten Zeit im Diamante- nen Sultanat eine ausgeprägte Abscheu gegen Dogmatismus und anmaßende Wahrheitsan- sprüche. Lehrer und Schüler Die Vorstellung des ‘Weges’ beinhaltet auch eine zeitliche Dimension des ‘vor’ und ‘hinter’ dem Wandernden liegenden ‘Wegstücks’: Alles Fortschreiten auf dem Weg kann nach tu- © 2005 Tyll Zybura | windfeder@wolkenturm.de | Quelle: www.wolkenturm.de 5 lamidischer Philosophie nur durch ständiges Sich-bewußt-sein des bereits bewältigten Stücks geschehen. Nur wenige Schüler erreichen durch eigene Leistung die dafür notwen- dige Erkenntnis, die meisten bedürfen der Anleitung und Begleitung auf ihrem Weg. Dies ist der Grund für die oft sehr engen Lehrer-Schüler-Verhältnisse im Tulamidenland. Die uralten tulamidischen Lehrsysteme beruhen auf einem durch detaillierte Regeln defi- nierten Verhältnis zwischen Lehrer (alam, Plural: ulema, Anrede: Sahib für beide Geschlech- ter) und Schüler (tâlib, Plural: tâlibun, Anrede: Sâl/Sâla). Der Lehrer wird in diesem Verhältnis als derjenige verstanden, der in der tariqa schon weit gelangt ist, der den Schüler mit der Tradition verbindet und es ihm erst ermöglicht, auf seinem eigenen Weg voranzukommen. Durch diese Abhängigkeit der Schüler ist die Auto- rität der Lehrer in den meisten chamibun uploads/Litterature/ die-tulamidische-gildenmagie.pdf
Documents similaires







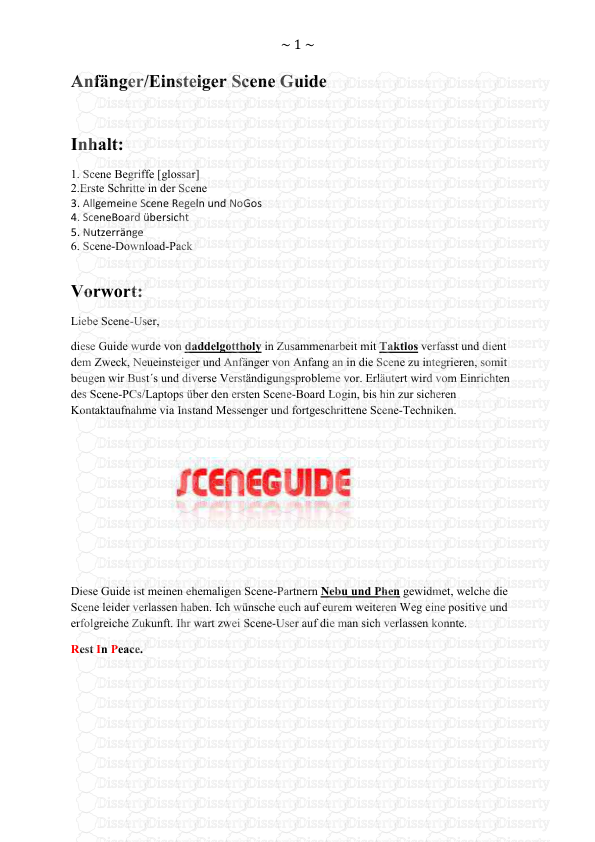


-
45
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 07, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1448MB


